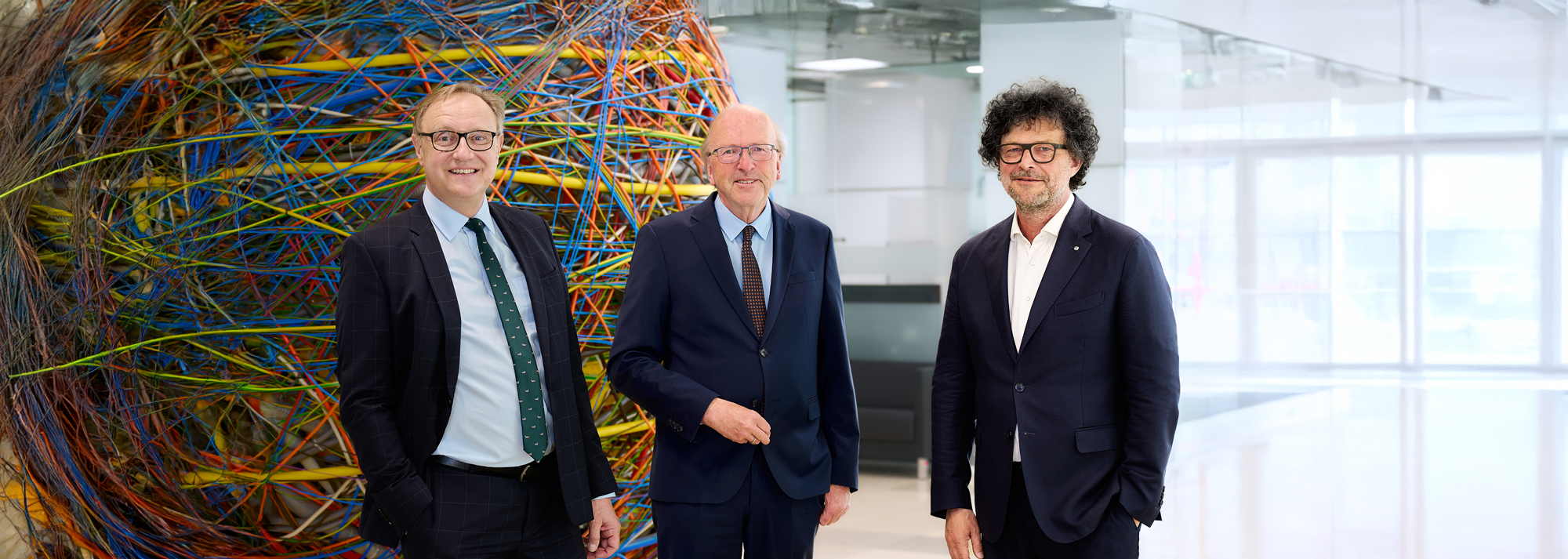
Startseite » IKB-Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2024 » Vorstandsinterview
Kreislaufwirtschaft in der DNA
Der IKB-Vorstand blickt zurück auf die positiven Entwicklungen des Jahres 2024, hebt die zahlreichen Kreisläufe der IKB hervor und macht damit die nachhaltige Dynamik sichtbar, die die IKB im Innersten zusammenhält. Schon immer.
Wie hat sich die IKB 2024 entwickelt?
DI Helmuth Müller: Das Geschäftsjahr 2024 war gut. Wir haben ein sehr gutes Ergebnis produziert – auch durch Einmaleffekte, die wir nicht wiederholen werden. Zwei Dinge möchte ich herausgreifen. Erstens: Wir hatten lange eine schwierige Situation im Strombereich, auch in Zusammenarbeit mit dem Aktionär TIWAG. Wir konnten mit Ende des Jahres 2024 diese Auffassungsunterschiede bereinigen. Das war sehr wichtig, und wir sind mit Beginn des Jahres 2025 in eine neue Phase der Zusammenarbeit gestartet. Zweitens: ein technisches Projekt, das uns fast zehn Jahre beschäftigt hat – die Umstellung der Stromzähler von elektromechanischen auf digitale Zähler. Wir haben über 120.000 Zähler ausgetauscht und im letzten Jahr das gesetzlich vorgegebene Ziel erreicht. Das war das größte Digitalisierungsprojekt des Unternehmens.
DI Thomas Gasser, MBA: Für mich war das Jahr 2024 ein Jahr der Konsolidierung und Stabilisierung. Beginnend 2022 mit dem Ukrainekrieg, der Gaskrise, der Strompreisexplosion und nachfolgend den ungeliebten Strompreiserhöhungen im Jahr 2023 ist es uns 2024 gelungen, wieder in ruhigere Fahrwässer zu kommen. Wir haben jetzt wieder ein Strompreisniveau erreicht, das sich die Kundinnen und Kunden leisten können. Es ist gemeinsam mit der TIWAG gelungen, den günstigsten Strompreis aller Landeshauptstädte anbieten zu können, was eine spürbare Entlastung für Familien und Kleinbetriebe ist. Das Schöne ist, dass wir eine extrem hohe Kundenloyalität haben, wir haben wenige Kundinnen und Kunden verloren und aufgrund von guten Services und Angeboten welche zurück- und dazugewonnen. Mit dem Thema Strom will sich niemand belasten, die Stromversorgung muss einfach funktionieren. 2024 ist wieder Ruhe eingekehrt, das tut uns allen gut.
Dr. Thomas Pühringer: Das Jahr 2024 bedeutete für mich 365 gute Tage – aber ein Tag war besonders gut. Das war der 19. Dezember 2024, als wir – ebenso nach zehn Jahren – unser großes Trinkwasserprojekt, den Ausbau der Mühlauer Quelle, vorläufig abgeschlossen haben. Restarbeiten finden 2025 noch bis Jahresmitte statt, aber wir haben die Anlage 2024 in Betrieb genommen und alle Projektziele erreicht. Das Projekt hat deutlich mehr gekostet als angenommen, aber die externen Fachleute, die alles genau untersucht haben, sprechen eine klare Sprache: Die Geologie ist gänzlich anders, als es uns die Expertinnen und Experten vorausgesagt haben. Das Projekt hat mehr gekostet, aber ich denke, auf eine Sicht von 100 Jahren lässt sich das verantworten. Wir haben zusätzliches Wasser gefunden, die Anlage nach über 70 Jahren im Betrieb saniert, Teile dazu gebaut und auch die Notversorgung sichern können. Der Wasserbedarf wird durch den Klimawandel und die Klimawandelanpassung steigen – jetzt sind wir gut gerüstet. Das ist in meinen Augen eines der wichtigsten Projekte für die Sicherung der Lebensgrundlage der Menschen und Betriebe in Innsbruck.
IKB sichert Innsbrucks Trinkwasserversorgung für Jahrzehnte
Gab es aus Ihrer Sicht Ereignisse, die das Jahr 2024 besonders machten?
Müller: Ein besonderes Ereignis war sicher die 30-Jahr-Feier. Übers ganze Jahr hinweg haben wir im Rahmen mehrerer Veranstaltungen insbesondere die Bevölkerung eingebunden und unser breites und heterogenes Leistungsspektrum bestmöglich gezeigt. Zu guter Letzt haben wir im November 2024 noch eine tolle Feier für unsere Mitarbeitenden veranstaltet, und ich glaube, wir haben dieses 30. Jubiläumsjahr des Unternehmens sehr gut, schön und würdig über die Bühne gebracht.
Pühringer: Der Blackout auf der Iberischen Halbinsel im April 2025 zeigte, dass ein derart langer Stromausfall die Menschen und Städte an ihre Grenzen bringt. Solch ein Szenario verbessert aber gleichzeitig auch das Verständnis dafür, wie wichtig es ist, dass wir bei uns in Innsbruck Tag für Tag für die verlässliche Ver- und Entsorgung arbeiten und oft lästig sind – wenn wir unsere Netze erneuern und alles in Schuss halten. Es ist besser, wir gehen den Leuten mit Baustellen auf die Nerven als mit Stromausfällen. Wir haben eine hohe Kompetenz im Haus und können dieses hohe Level halten, dafür sind wir sehr dankbar. Das ist und bleibt ein wichtiger Aspekt.
Herr Gasser, wie geht es Ihnen als Stromexperte, wenn Sie von derart großflächigen Stromausfällen hören? Werden Sie da nervös?
Gasser: Ja. Definitiv. Was auf der Iberischen Halbinsel passierte, kann man ja nicht ausprobieren, doch es gibt gute Konzepte – und, wie man in Spanien und Portugal gesehen hat, haben die Konzepte funktioniert. Diese Übung ist nicht lustig, weil der Ausgang ungewiss ist. Wenn bei uns gemeckert wird, dass die Energie so teuer ist, müssen wir schon auch sehen, dass die Versorgungssicherheit enorm hoch ist – und das in allen Bereichen, die die IKB anbietet. Ob Strom, Wasser, Kanal, Abfallentsorgung oder Datenkommunikation.
„In den letzten Jahren haben wir wichtige Schritte gesetzt, um das Grundwasser zu nutzen, Gebäude zu kühlen oder über Wärmepumpenprozesse im Winter zu heizen.“
DI Helmuth Müller

Der Bericht 2024 steht unter dem Motto „IKB-Kreislaufkraft“. Welche besondere Kraft steckt in den IKB-Kreisläufen?
Müller: Es sind vielleicht noch kleine Kreisläufe, aber trotzdem etwas Besonderes: In den letzten Jahren haben wir wichtige Schritte gesetzt, um das Grundwasser zu nutzen, Gebäude zu kühlen oder über Wärmepumpenprozesse im Winter zu heizen. Im Zusammenhang mit dem Raiqa-Neubau und dem Neubau der Tiroler Versicherung haben wir Grundwasserbrunnen und Grundwassernetze errichtet und in Betrieb genommen. Wir transportieren das Grundwasser über Leitungen in die Objekte, dort wird es zum Wärmen oder Kühlen genutzt, und dann wird das Grundwasser wieder in das Leitungsnetz zurückgegeben. Das heißt, wir verbrauchen kein Grundwasser, und ich glaube, das wird in Zukunft einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten. Da steckt viel Grips dahinter und viel Engagement, und das ist der Kreislauf, der mich momentan am meisten begeistert. Das ist schon cool.
Gasser: Ich möchte einen alten Kreislauf, den Wasserkreislauf nennen. Es regnet auf die Nordkette, das Wasser diffundiert zehn Jahre lang durch den Berg, wird im Mühlauer Stollen erschlossen und in einem Wasserkraftwerk abgearbeitet. Dann geht das Wasser in den Speicher und dient der Innsbrucker Bevölkerung und den Betrieben als ihr Trinkwasser. Was übrig ist und nicht gebraucht wird, wird noch einmal abgearbeitet, und es wird wieder erneuerbare Energie daraus gemacht. Das Ganze geht dann in den Stromkreislauf – und Strom ist immer ein Kreislauf. Das sind alte physikalische, natürliche Kreisläufe, die die IKB und die Vorgängerunternehmen über Jahrzehnte perfektioniert haben.
Pühringer: Und neben der energetischen Komponente ist unser Trinkwasser auch das Lebenselixier, unentbehrlich für Mensch, Umwelt und Wirtschaft. Wasser ist Leben. Dass unser Wasser eine derart hohe Qualität hat, wir es nicht bestrahlen oder behandeln und auch keinen Aufwand damit betreiben müssen, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Nach dem Gebrauch – wofür auch immer – geht es über die Kanalisation in die Kläranlage und in den Inn. Das ist perfekt, sowohl auf der energetischen als auch der hydrologischen Seite. Eine super Geschichte.
Und alle Kräfte werden genutzt?
Pühringer: Genau. Alles wird genutzt, und es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu: Viele Städte müssen 100 Prozent ihres Trinkwassers aus dem Boden, also aus dem Grundwasser, heraufpumpen. Bei uns kommt es direkt aus dem Berg, und wir produzieren sogar noch Strom mit unserem Trinkwasser.
Herr Müller, all diese Kreisläufe und das nachhaltige Handeln sind seit jeher ein wichtiger Bestandteil der IKB und in der Satzung verankert. Warum ist das für die IKB so zentral und was macht die Kreisläufe so nachhaltig?
Müller: Kreisläufe sind von Haus aus nachhaltig, sie verbrauchen keine Ressourcen, welche die nächsten Generationen vielleicht brauchen könnten. Wenn Sie unsere Satzung ansprechen, bin ich immer wieder beeindruckt, dass man in den Jahren 1993/94 – bevor das Unternehmen gegründet wurde – das Wort Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung in die Satzung aufgenommen hat. Das Wort war damals noch nicht populär, zwischenzeitlich wird es ja fast zu viel verwendet. Aber die Satzung damals hat wirklich die Komponenten des ökologischen, sozialen und des wirtschaftlichen Aspekts in ihrer Gesamtheit gesehen, das ist schon bemerkenswert.
Pühringer: Es ist schon ein großes Qualitätsmerkmal, wenn man 30 Jahre später immer noch sagen kann: Das passt.
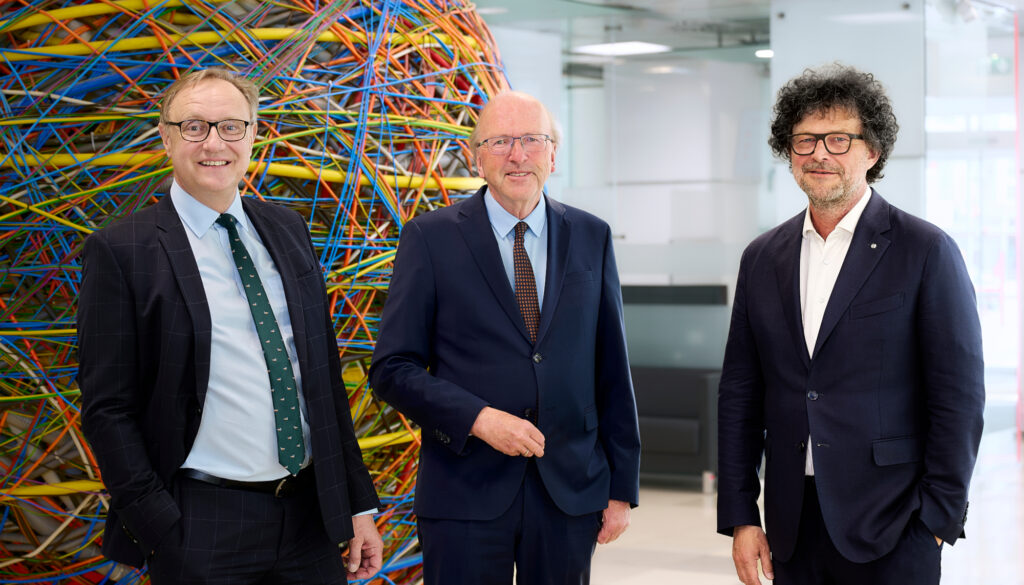
Welche Kreisläufe werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen?
Müller: Auf alle Fälle wird das von mir schon erwähnte Grundwasserthema ein wesentlicher Punkt sein. Im Zusammenhang mit Strom und Stromerzeugung ist sicher eine der großen Herausforderungen, die Energie, die wir zu einer bestimmten Jahreszeit im Überfluss haben – ich denke an die Sonnenenergie und Wasserkraft im Sommer – in Jahreszeiten zu verlagern, wo wir zu wenig haben, nämlich in den Winter. Das ist dann der Jahreskreislauf, den man noch zimmern muss und der sehr herausfordernd sein wird. Das wird die technologische Herausforderung, die im Zusammenhang mit der Energiewende zu sehen ist. Im Kleineren ist die Verlagerung vom Tag in die Nacht schon möglich, die Frage ist nur, wann es auch wirtschaftlich sein wird.
Gibt es da Schwerpunkte, die die IKB setzen will oder schon setzt, um auch in Zukunft die Nase vorn zu haben?
Müller: Wir werden 2025 in einen größeren Batteriespeicher investieren, der Ende des Jahres in Betrieb gehen wird. Der wird an einem Kraftwerksstandort stehen, direkt von der Wasserkraft gespeist und auch bewirtschaftet werden. Das ist nicht nur eine Investition, mit der wir Geld verdienen wollen, sondern wir wollen lernen, mit diesen Systemen zu arbeiten, um in weiterer Folge in angepasste Systeme zu investieren. Zum Thema Energiespeicher gibt es viele Ideen, auch kuriose Ideen – wie etwa den Sandspeicher, in dem Wärme gespeichert wird, die im Winter abgerufen werden kann. All diese Dinge muss man im Auge haben und das eine oder andere auch mal probieren. Wenn wir da nichts machen, wird die Energiewende vorbeiziehen, und wir haben es versäumt.
Pühringer: Das gilt auch für andere Bereiche. Gerade der Baubereich ist sehr ressourcenintensiv – im Hochbau wie im Tiefbau. Es geht hier etwa um eine verbesserte Recyclingquote oder darum, was mit Fräsasphalt oder Betonbruch gemacht werden kann. Und da sind wir wieder beim Thema Speicher: Es gibt etwa Versuche, den Betonbruch als Wärmespeicher zu nutzen. Auch die E-Mobilität ist wichtig. Wir haben den ersten rein elektrischen Abfallsammel-Lkw nun ein Jahr in Betrieb, und die Effizienz ist sehr beeindruckend. Beim Vergleichsfahrzeug, das wir zuvor auf dieser Tour in Gebrauch hatten, haben wir 85 Liter Diesel pro 100 Kilometer gebraucht. Wenn wir den Stromverbrauch in Diesel umrechnen, so liegen wir mit dem rein elektrischen Fahrzeug bei 13 Litern pro 100 Kilometer. Das ist schon eine tolle Geschichte. Und dann kommt noch der Wirtschaftskreislauf hinzu, weil wir das Geld nicht mehr dazu verwenden müssen, um fossilen Treibstoff zu kaufen, sondern den E-Lkw mit Strom laden, den wir zu mindestens 50 Prozent selbst erzeugen. Das Geld, das wir von den Kundinnen und Kunden bekommen, investieren wir stattdessen in die Region.

„Wir haben den ersten rein elektrischen Abfallsammel-Lkw nun ein Jahr in Betrieb, und die Effizienz ist sehr beeindruckend.“
Dr. Thomas Pühringer
Viele Unternehmen bereiten sich auf Verpflichtungen zur transparenten Berichterstattung von Nachhaltigkeit vor. Wo steht die IKB in diesem Zusammenhang?
Müller: Wir haben bereits im Geschäftsjahr 2011 begonnen, einen integrierten Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen – orientiert an den jeweils aktuellen Standards. Das Wichtigste war aber nicht der Bericht selbst, sondern waren die Maßnahmen, die letztendlich durch das Nachhaltigkeitsmanagement abgeleitet, geplant und umgesetzt wurden. In den letzten zwei, drei, vier Jahren ist durch den Green Deal der EU auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung stark in den Mittelpunkt gerückt, man will mit der Berichterstattung die Geldströme der großen Investorinnen und Investoren zu Organisationen und Unternehmen lenken, die nachhaltiges Geschäft betreiben. Die aus dieser Initiative abgeleiteten Regeln und Regularien hätten enormen Aufwand bedeutet. Seit Anfang 2025 hat die EU auf die Pausetaste gedrückt, man will bis zu 80 Prozent der vorgegebenen Regeln und Regelwerke reduzieren und hat die Frist um zwei Jahre hinausgeschoben. Wir haben uns auf Konzernebene jedenfalls bereits gut vorbereitet und arbeiten weiter daran.
Welche Projekte werden die IKB in Zukunft noch nachhaltiger machen?
Müller: Wir haben beispielsweise einen knapp zwölf Kilometer langen Abwasserkanal aus dem Stubaital zu unserer Kläranlage errichtet. Im Stubaital gibt es eine alte, am Ende ihrer Lebensdauer angelangte Kläranlage, die komplett erneuert werden müsste, und wir haben mit den Gemeinden vereinbart, stattdessen den Kanal nach Innsbruck zu errichten. Die Gemeinden müssen somit keine neue Anlage bauen und werden ihre Abwässer in unsere Kläranlage einleiten. Das ergibt für die Gemeinden aus dem Stubaital viel Sinn – und auch für die anderen bereits jetzt in die Kläranlage einleitenden 14 Gemeinden, weil sich die Kosten entsprechend verdünnen. Das ist jedenfalls unter Nachhaltigkeit einzureihen.
Pühringer: Und im Stubaital sparen nicht nur die Gemeinden viel Geld, sondern auch die Haushalte und Betriebe.
Wenn ein großes Projekt wie dieses ansteht, welche Vorarbeiten müssen da geleistet werden – in der Kläranlage, aber auch im Rahmen der Planung?
Pühringer: Es gibt natürlich die technische Komponente, die komplex genug ist. Dann gibt es die betriebswirtschaftliche Komponente – und noch etwas, das viel Fingerspitzengefühl erfordert und nicht unterschätzt werden sollte: die gute Zusammenarbeit mit den vielen externen Partnerinnen und Partnern. In einem Ortsteil von Mutters graben wir beispielsweise unmittelbar vor einem Wohnhaus für den Kanal. Da sind gute Gespräche mit den Anwohnerinnen und Anwohnern extrem wichtig, damit sie das Projekt verstehen und mittragen. Das ist ein wichtiger Teilschlüssel bei jeder Projektumsetzung, denn jedes Grundstück, auf dem wir unsere Netze betreiben, gehört jemand anderem: der Stadt Innsbruck, einer anderen Gemeinde oder Privaten. Damit muss man gut umgehen.
Herr Pühringer, kommen wir wieder zum Thema Kreisläufe zurück. Ein weiterer Kreislauf, der die großen wie kleinen Welten bewegt, ist das Recycling. Sie haben schon erwähnt, dass der Effekt des E-Lkws Sie beeindruckt hat. Gibt es andere Dinge, die 2024 im Abfallbereich herausstechen?
Pühringer: Die Verstärkung der Abfallberatung. Wir haben uns entschieden, vor allem an den Schulen, bei den ganz jungen Menschen in unserer Gesellschaft, Bewusstsein für das Vermeiden, das richtige Trennen und Recycling zu schaffen. Ich denke, das ist ein wirkungsvoller Weg, weil jeder von uns einen wichtigen Beitrag leisten kann. Wir haben zwei sehr engagierte junge Kollegen, die einen richtig guten Job machen. Außerdem treten wir auch aktionistisch auf: Bei der Innuferreinigung haben 2024 wieder knapp 200 Leute mitgemacht. Dann gibt es noch die Problemstoffsammlung und viele weitere Projekte, die positiv herausstechen.
Das Glasfasernetz ist zwar kein Kreislauf, aber dennoch zentral für die Zukunftsentwicklung von Innsbruck. Welche Schritte wurden 2024 in diesem Bereich gesetzt?
Pühringer: Wir sind im Telekombereich mit dem vierten Rechenzentrum sehr weit gekommen. Ein kurzer Exkurs: Damit lokale Unternehmen ihre digitalen Daten sicher bei uns speichern können, haben wir zuvor bereits einen alten Trinkwasserbehälter, der nicht mehr in Gebrauch ist, zu einem Rechenzentrum umgebaut – mit teils eineinhalb Meter dicken Mauern und höchsten Sicherheitsstandards. Das schafft Vertrauen bei unseren Kundinnen und Kunden. 2024 wurde ein ähnliches Projekt mit einem Kunden umgesetzt, der im Hochleistungsbereich Rechenoperationen durchführt. Wir schaffen die Voraussetzung dafür. Und das Glasfasernetz wächst und wird auch intensiver genutzt. Ein großer Erfolg war außerdem, dass wir mit den zwei größten Telekomprovidern, die bundesweit tätig sind, Verträge geschlossen haben. Diese bauen jetzt nicht mehr ihre eigenen Netze aus, sondern mieten sich in unsere Leitungen ein. Das heißt, dass der Bestand, der schon in der Erde liegt, intensiver genutzt wird. Das ist volkswirtschaftlich, für die Kundinnen und Kunden, für die beteiligten Unternehmen und auch für uns sinnvoll. Wenn alle etwas davon haben, ist das ein Kreislauf.
IKB erneut unter den Top 5 Glasfaseranbietern in Österreich
Ein heiß diskutiertes Thema sind die Tiroler Bäder. Wie geht es den Innsbrucker Bädern?
Pühringer: Grundsätzlich gut, wobei wir in der drängendsten Frage der Höttinger Au noch von konkreten Zu- oder Absagen der öffentlichen Hand abhängig sind. Wir dürfen nur einen bestimmten Basisbetrag aus dem eigenen Ergebnis für die Bäder verwenden. Alles, was diesen Betrag übersteigt, müssen wir von dritter Seite zugeschossen bekommen. Insofern hoffe ich, dass wir da im laufenden Geschäftsjahr mehr Klarheit bekommen. Grundsätzlich halten wir die Anlagen in Schuss. Das Tivoli ist von einer Expertenrunde vor einiger Zeit zu einem der schönsten Gebäudekomplexe Österreichs gewählt worden. Ja, wir schauen, dass alles in Ordnung ist.
Herr Gasser, Ihre Zuständigkeiten betreffen mit den Geschäftsbereichen Strom-Erzeugung und Strom-Vertrieb ein stark pulsierendes Herz der IKB. Wie zufrieden sind Sie mit der Stromerzeugung im Jahr 2024?
Gasser: Wenn man mit 2024 nicht zufrieden ist, ist man ein unzufriedener Mensch. Ich stelle aber noch vor der Rekorderzeugung einen unfallfreien Betrieb in den Vordergrund. Von den Anlagen geht ein gewisses Gefährdungspotenzial aus – wir arbeiten im Kraftwerksbetrieb, und dass die vielen Hochwassersituationen gut ausgegangen sind, ist sehr erfreulich. Auch erfreulich ist, dass 2024 ein sehr gutes Wasserjahr war. Wir hatten 15 Prozent zusätzliche Erzeugung. Wir haben zig Millionen Kilowattstunden geschenktes Wasser von oben bekommen, durch viel Niederschlag. Und das heißt, wir mussten weniger Strom für die Versorgung unserer Kundinnen und Kunden zukaufen.
Wie hat sich die Sonne bewährt?
Gasser: Die Photovoltaik ist eine Erzeugungsform mit all ihren Vor- und Nachteilen. Sie wurde in den vergangenen Jahren stark gehypt, was dazu führt, dass der Strom im Sommer nichts mehr wert ist und wir Wasserkraftwerke vom Netz nehmen müssen. Das Stromsystem ist ein höchst fragiles physikalisches System, das auch volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Aspekte hat. Da muss man der Photovoltaik den Platz einräumen, den sie verdient: Sie ist eine Abrundung der Erzeugung und immer dann gut, wenn man untertägig hohe Verbräuche hat. Dann ist es eine sehr günstige Erzeugungsform.
Wir haben die neuen Speichermöglichkeiten schon angesprochen. Auf der ganzen Welt wird fieberhaft daran gearbeitet und geforscht. Es ist die Kernfrage der Energiewende. Wie widmet sich die IKB diesen Schlüsseltechnologien?
Gasser: Strom per se kann nur chemisch gespeichert werden, oder man speichert potenzielle Energie, indem man Wasser in Depots in Speicherseen aufspart und dann bei Bedarf herunterlässt und abturbiniert, also zur Stromerzeugung nutzt. Die IKB verfügt leider über kein solches Pumpspeicherkraftwerk, und wenn man die entsprechenden Genehmigungsverfahren betrachtet, ist so ein Kraftwerk auch unrealistisch für die IKB. Darum haben wir im letzten Jahr das bereits angesprochene Projekt für eine chemische Speicherung initiiert, eine große Batterie, die wir im Laufe des Jahres 2025 am Kraftwerksstandort Obere Sill installieren werden. Das wird eine der größten Batterien werden, die es in Tirol gibt. Wir kennen diese Technologie noch nicht, sind aber guter Dinge, dass wir sie gut einsetzen können, um eine systemdienliche Speicherung zu ermöglichen – also Strom dann aus dem Netz zu nehmen, wenn überschüssiger Strom da ist, beziehungsweise in Stunden hoher Nachfrage wieder abzugeben. Das dient der Stabilisierung des Stromnetzes, und wir werden damit auch Geld verdienen und den wirtschaftlichen Kreislauf schließen. Wenn man sieht, dass das Modell nachhaltig funktioniert, kann man da zwei, drei oder vier daraus machen.
Gibt es andere Möglichkeiten, die Überschussenergie zu nutzen?
Gasser: Wir haben auch die Einschaltzeiten unserer Elektroboiler in die Tagstunden verlegt. Das entlastet das Netz tagsüber, weil Strom, der produziert wird, direkt in den Verbrauch geht. Parallel dazu betreiben wir im Hallenbad Amraser Straße eine sogenannte Power-to-Heat-Anlage: Wir heizen das Bad immer dann mit Strom, wenn Stromüberschuss vorhanden und sehr günstig ist. Das ist extrem effizient.
„Das Schöne ist, dass in der IKB viele kluge Leute mit klugen Projektideen kommen.“
DI Thomas Gasser, MBA

In all diesen Rädchen steckt sehr viel Know-how der IKB und ihrer Mitarbeitenden. Eine schöne Geschichte?
Gasser: Ja, das Schöne ist, dass in der IKB viele kluge Leute mit klugen Projektideen kommen. Bei der Idee zum Stubaitalkanal gab es etwa einen Mastermind und beim Rechenzentrum im alten Trinkwasserspeicher ebenso. Ich finde es extrem erfrischend, wenn Leute kommen und sagen: Da könnte man doch was machen!
Was wünschen Sie sich für das Stromjahr 2025?
Gasser: Wieder einen unfallfreien Betrieb und endlich Wasser. Es ist bis dato extrem trocken. Im April hätte die Schneeschmelze einsetzen müssen, doch es gab im letzten Winter sehr wenig Schnee. Und Regen ist auch keiner in Sicht. Das ist heuer wirklich bitter, und der Beitrag der Erzeugung zum Unternehmensergebnis wird 2025 definitiv nicht so groß wie 2024 sein. Ja, ich wünsche mir ganz viel Wasser.
Und zum Abschluss noch eine Frage an alle: Was möchten Sie 2025 in und mit der IKB erreichen?
Müller: Dieses Jahr ist mein letztes Jahr in der IKB. Die IKB und vor allem die Leute, die mit uns gemeinsam arbeiten, ist ein Herzensprojekt von mir. Der Wunsch ist, dass unser Aufsichtsrat die richtige Entscheidung betreffend das Vorstandsmitglied, das mir nachfolgen soll, trifft. Es geht um die Zusammenarbeit im Vorstand – und wenn das Vorstandsteam funktioniert, dann funktioniert auch das große Team mit unseren 800 Leuten. Ich wünsche unseren Leuten, dass das gelingt. Und ich glaube auch daran.
Pühringer: Ja, das hätte ich auch gesagt. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Genauso entscheidend ist, dass wir – da viele Menschen in Pension gehen – ausreichend Mitarbeitende finden, die einen Sinn in der Tätigkeit bei uns sehen und gerne mit uns für die Versorgungssicherheit in Österreich und Innsbruck arbeiten. Weil wir so viele verschiedene Geschäftsbereiche haben, brauchen wir viele verschiedene Expertinnen und Experten. Auch wünsche ich mir, dass wir es verstehen, die Dinge, die wir tun, gut zu kommunizieren.
Gasser: Dass das Vorstandsteam gut funktioniert, ist natürlich auch mir ein Anliegen. Ressourcen und Mitarbeitende ebenso – und dass uns die Ideen nicht ausgehen, wir die Kreativität und den Spannungsbogen halten können. Es ist ganz wichtig, dass Ideen zugelassen, an uns herangetragen werden und wir sie dann abarbeiten. Das ist keine Kleinigkeit.
Mehr zu den IKB-Kreisläufen:
Aus Abwärme wird Nutzwärme: So heizt das Umspannwerk die IKB-Zentrale
Im Umspannwerk Mitte wandeln Transformatoren die Stromspannung um. Dabei geht Energie in Form von Wärme verloren. Wie die IKB diese Abwärme nützt, um ihre Betriebszentrale zu heizen und wo in ...
Wie Klärschlamm und Biomüll zu Wärme werden: die Heizung aus der Kläranlage
Bei der Reinigung des Abwassers entsteht Klärschlamm. Die IKB erzeugt daraus – und aus Innsbrucker Biomüll – Klärgas, das in Blockheizkraftwerken in Strom und Wärme verwandelt wird. So wird das ...
Von der Turbine bis zur Steckdose
Die IKB erzeugt erneuerbare Energie für Innsbruck aus Wasser, Sonne und Biomasse. Was nicht sofort verbraucht wird, muss über Umwege zwischengespeichert werden. Dafür arbeitet die IKB an neuen Speichermöglichkeiten. Diese ...
Vom „Überschuss“ zur wertvollen Wärme
So sparen die IKB-Bäder Energie: Ein gigantischer Pufferspeicher liefert Heizwärme aus Stromüberschuss. In den Becken und Schwimmhallen wird die Wärme durch Filter und Lüftungen im Kreislauf gehalten.
...Recycling von der Weinflasche zum Trinkglas
Damit Abfallrecycling funktioniert, müssen die Dinge, die im Müll landen, sorgfältig getrennt werden. Dreh- und Angelpunkt für die Wiederverwertung ist der IKB-Recyclinghof in der Roßau. Was passiert dort genau? Und ...
Alles im Fluss
Dass bestes Trinkwasser aus dem Hahn strömt, ist für Innsbrucker:innen selbstverständlich. Doch das Wasser hat eine lange Reise hinter sich. Und wenn es verbraucht wurde, geht diese noch weiter. Die ...
Grundwasser: „Eine wirklich lokale Ressource“
Die IKB baut und betreibt seit 2016 Grundwassernetze in Innsbruck, die den thermischen Heiz- und Kühlbedarf für eine Vielzahl von Gebäuden bereitstellen. Wie dieser nachhaltige Nutzungskreislauf funktioniert, erklärt IKB-Mitarbeiter Moritz ...






